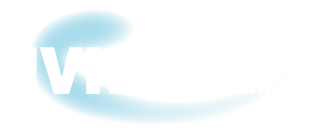Lötrauchabsaugung - Absauganlage für Lötrauch
Absaugung von Lötrauch - für eine gesunde und saubere Luft am Arbeitsplatz
Beim Löten, beispielsweise Weichlöten oder Hartlöten, entstehen unterschiedliche giftige und gesundheitsgefährdende Stäube und Rauch – sogenannter Lötrauch. Dies ist vor allem abhängig von der Materialzusammensetzung des Metalls und den Temperaturen, die beim Löten verwendet werden. Jedoch gelangen all diese Schadstoffe wie Formaldehyd des Lötprozesses ohne den Einsatz einer sogenannten Lötrauchabsaugung ungehindert in die Raumluft und können erhebliche Schäden anrichten.
Daher haben Arbeits- und Gesundheitsschutz in produzierenten Gewerben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Teilweise gibt es für spezielle Anwendungen bereits Vorschriften, die beim Löten eine Absaugung vorschreiben, die sogenannte Lötrauchabsaugung. Vor allem schützen Sie durch den Einsatz einer Lötrauchabsaugung nicht nur Ihre Mitarbeiter, sondern auch Ihre Maschinen. Denn diese würden beispielsweise aufgrund von Verschmutzungen nicht mehr akkurat fertigen können und somit die Qualität der Endprodukte beeinträchtigen.
Mit dem Einsatz einer Löt-Absauganlage Gutes tun für Ihre Mitarbeitenden, Produkte und Umwelt
Lötrauchabsaugung für jeden Zweck
Für einzelne Lötarbeitsplätze eignen sich kompakte, mobile Absaugungen für Lötrauch am besten. Jedoch ist bei einer Mehrplatzabsaugung oder einer automatisierten und teilautomatisierten Fertigung der Einsatz einer zentralen Lötrauchabsaugung empfehlenswert. Daher ist eine mobile oder stationäre Absaugung für das Löten durch ihren Filteraufbau (Gas- & Partikelfilter, Aktivkohle, Streckmetallfilter) sehr gut individualisierbar. Außerdem sind Absauganlagen größtenteils für den Dauerbetrieb geeignet und stehen in ESD-Ausführung zur Verfügung. Darüber hinaus können die Absaugungen zum Löten mit einer integrierten Steuerung, sowie mit einer Filterüberwachung ausgestattet werden. Der Vorteil hiervon ist, dass zum Schutz Ihrer Mitarbeiter auf gesättigte Filter hingewiesen wird, um die Arbeitssicherheit jederzeit zu gewährleisten.
Um die höchste Effektivität einer Absaugung von Lötrauch zu gewähren, ist es wichtig, die Erfassung der Absaugung während des Lötens nahe an der Entstehungsstelle anzubringen, da dort die größtmögliche Schadstoffmenge erfasst werden kann. Hierfür ist das richtige Erfassungselement für das Löten in Form einer Flachhaube oder Saugspitze ausschlaggebend.
Einsatzbereiche für Absaugung Lötrauch: Handlötarbeitsplätze mit Lötkolben, Lötstationen, Reflowlöten, Selektivlötanlagen, Roboterlötzellen, Laserlötanlagen, Heißluftlöten, Dampfphasen-Lötanlagen, Lötbäder.
Geräteübersicht der Lötrauchabsaugungen
Was ist bei der Auswahl der richtigen Lötrauchabsaugung zu beachten?
- Welches Material wird verwendet? Gibt es ggf. ein Sicherheitsdatenblatt mit Anforderungen.
- An wie vielen Stellen soll abgesaugt werden? (Einzel- oder Mehrplatzabsaugung)
- Wie wird gelötet? (Handlöten mit Lötkolben oder Lötmaschinen wie Reflowlöten, Wellenlöten)
- Wie viele Stunden am Tag und in der Woche muss die Lötrauchabsaugung aktiv sein?
- Soll die gereinigte Luft zurück in den Raum geführt werden oder nach außen in die Abluft?
- Soll die Absaugung mobil sein oder hat diese immer einen festen Stellplatz?
- Ist eine Schnittstelle zur Kommunikation mit der Produktionsmaschine notwendig?
- Ist eine Partikelbelegungsanzeige mit Hinweis auf gesättigte Filter notwendig?
- Wird ein Erfassungselement benötigt, wenn ja welches? (Flachhaube, Saugspitze)
Abgekündigte Produkte
Baureihen:
150
200
210
220
250
1000
Jetzt Kontakt aufnehmen
Wir beraten Sie gerne über die passende Lötrauchabsaugung.
Lötrauchabsaugung – Fakten, Normen, Auslegung
Eine fachgerecht geplante Lötrauchabsaugung mindert Emissionen aus Kolophonium-Flussmitteln, Aldehyden, Chlorwasserstoff und Metallverbindungen. Dieser Leitfaden bündelt Grundlagen, Funktionsprinzip, Regelwerk und praxisnahe Auslegung für Arbeitsplätze in der D-A-CH-Region.
Grundlagen & Abgrenzung
Lötrauch entsteht beim Erhitzen von Lot und Flussmittel. Beim Weichlöten sind typischerweise Aldehyde aus Kolophonium-Flussmitteln relevant; beim Hartlöten zusätzlich Chlorwasserstoff, je nach eingesetztem Flussmittel. Weichlote enthalten häufig bereits etwa 2–3 % Flussmittel. TRGS 528 ordnet alle Lötverfahren dem Geltungsbereich „schweißtechnische Arbeiten“ zu und benennt die entstehenden Gefahrstoffe. Für die Beurteilung am Arbeitsplatz sind sowohl Partikel als auch Gase zu berücksichtigen.
Die A-Staub-, E-Staub- und alveolengängige Fraktionen sind in DIN EN 481:1993 definiert und dienen als Grundlage für Mess- und Bewertungsverfahren. Für konkret benannte Stoffe gelten in Deutschland die Arbeitsplatzgrenzwerte nach TRGS 900 (z. B. Formaldehyd).
Kurz gesagt: Lötrauch ist ein Stoff- und Gasgemisch. Relevante Komponenten und Grenzwerte ergeben sich aus Flussmittel, Lötverfahren und TRGS/DIN-Regelwerk.
So arbeitet das System: Prinzip & Aufbau
Eine Lötrauchabsaugung funktioniert wirksam, wenn die Erfassung nahe an der Entstehungsstelle erfolgt. Geeignete Erfassungselemente sind:
Lötspitzennahe Erfassung (aufgesetzte Düsen, kleine Hauben) für Handarbeitsplätze.
Flexible Absaugarme mit Haube für variierende Positionen.
Brennerintegrierte oder punktförmige Erfassung bei Hartlöten.
TRGS 528 unterscheidet Hochvakuum- (HV) und Niedrigvakuum- (NV)-Systeme: HV arbeitet mit Unterdrücken ab etwa 8 000 Pa und kleineren Schlauchdurchmessern (typisch 60–80 mm), NV bis etwa 3 000 Pa mit größeren Durchmessern (typisch 150–160 mm). Die Wahl beeinflusst Handhabung, Leitungsverluste und Geräuschentwicklung.
Der weitere Aufbau umfasst Vorabscheider gegen Funken/Partikel, Hauptfilter (z. B. Partikelfilter hoher Abscheideleistung) und nach Bedarf Gasfilter (z. B. Aktivkohle) gegen Aldehyde und andere Gase. Strömungsführung, Dichtheit und einfache Nachführung der Erfassungselemente sind entscheidend: Schwer bewegliche Arme werden erfahrungsgemäß seltener korrekt positioniert.
In der Praxis … Die erfasste Luftmenge muss zum Erfassungselement passen. ISO 21904-4 gibt Verfahren vor, um den Mindest-Luftvolumenstrom von Erfassungseinrichtungen zu bestimmen; pauschale „Standardwerte“ ersetzen diese Prüfung nicht.
Regelwerk kompakt
TRGS 528:2020 „Schweißtechnische Arbeiten“ – gilt explizit auch für „alle Lötverfahren“. Nennung der typischen Gefahrstoffe beim Weich-/Hartlöten, Auswahl von Erfassungsarten, Hinweise zu HV/NV-Systemen.
TRGS 900: aktuelle AGW – enthält rechtsverbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte. Beispiel: Formaldehyd 8-h-AGW 0,37 mg/m³ (0,3 ppm); Kurzzeitwert 0,74 mg/m³ (0,6 ppm).
TRGS 402:2023 – Vorgehen zur Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposition (Mess- und Beurteilungsstrategie).
TRGS 907:2011 – Verzeichnis sensibilisierender Stoffe; relevant bei Kolophonium-Exposition.
DGUV Regel 109-002 „Arbeitsplatzlüftung – Lufttechnische Maßnahmen“ – Auswahl, Planung und Betrieb lüftungstechnischer Schutzmaßnahmen, inkl. Anforderungen an Erfassung und Rückführung.
DIN EN ISO 21904-1/-2/-4:2020 – Anforderungen und Prüfverfahren für Einrichtungen zum Erfassen und Abscheiden von Rauch; Teil 4: Bestimmung des Mindest-Luftvolumenstroms.
VDI 2262 Blatt 3:2011 – Lufttechnische Maßnahmen zur Minderung der Exposition am Arbeitsplatz.
DIN EN 481:1993 – Definition der Partikelfraktionen am Arbeitsplatz.
Kernaussage: Rechtskonforme Lötrauchabsaugung orientiert sich an TRGS 528/402/900 und setzt ISO 21904-geprüfte Erfassung und Filterung um; pauschale Richtwerte ersetzen keine Gefährdungsbeurteilung.
Planung & Dimensionierung
Ausgangspunkt ist die Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV und TRGS 402. Folgende Kriterien bestimmen die Auslegung:
Verfahren & Stoffe: Weichlöten mit Kolophonium-Flussmitteln erfordert Partikel- plus Gasabscheidung; Hartlöten kann HCl-Belastungen erzeugen.
Arbeitsplatztyp: Einzelarbeitsplatz mit Lötspitze vs. Linienfertigung; stationär vs. mobil. Kurze Wege und geringe Leckagen verbessern die Erfassung.
Erfassungselement: Haubengeometrie, Abstand, Sichtfeld und Beweglichkeit. ISO 21904 fordert u. a. Kennzeichnung und Prüfwerte für Erfassungseinrichtungen.
HV vs. NV: HV eignet sich für punktnahe Erfassung (kleine Düsen, lange Schlauchwege), NV für größere Hauben mit höherem Volumenstrom. Leitungsführung, Umlenkungen und Dichtheit sind mitzuberechnen.
Filterkonzept: Stufiger Aufbau (Vorabscheider/Partikel/Gas). Wechselintervalle und Sättigungsindikatoren planen.
Rückführung vs. Fortluft: Rückführung nur, wenn rechtlich zulässig, technisch sinnvoll (ausreichende Abscheidung) und die Exposition unter AGW liegt; sonst Fortluft.
Pragmatische Regel: Erfassung an der Quelle hat Vorrang vor Raumlüftung. Raumlüftung ergänzt, ersetzt aber keine wirksame punktuelle Lötrauchabsaugung.
Für die Auslegung des Luftvolumenstroms an Düsen/Hauben sind die Verfahren nach DIN EN ISO 21904-4 anzuwenden. Dokumentieren Sie Prüfergebnisse, Kennzeichnung der Erfassungseinrichtungen und die Einhaltung der AGW im Rahmen der Expositionsbeurteilung.
Kurz gesagt: Dimensionierung folgt dem Prozess, nicht umgekehrt. Erfassung, Volumenstrom, Filter und Betriebsmittel bilden eine abgestimmte Einheit.
Sicherheit, Arbeitsschutz, Betrieb & Wartung
Gefährdungsbeurteilung: Stoffinventar (Sicherheitsdatenblätter), Tätigkeitsbeschreibung, Bewertung nach TRGS 402. Prüfen, ob sensibilisierende Stoffe nach TRGS 907 betroffen sind.
Betriebsanweisungen & Unterweisung: Klar regeln: Erfassungselement stets nah an die Quelle; Betriebszustände, Filterwechsel, Entsorgung.
Wartung & Wirksamkeitskontrolle: Regelmäßige Funktionsprüfungen, Dichtheits-/Volumenstromkontrollen, Filterwechsel nach Zustand/Herstellerangaben; Nachweis der Wirksamkeit dokumentieren.
Rückführung: Nur mit geeigneter Abscheideleistung und bei sicherer Einhaltung der AGW. Sonst Fortluftführung, ggf. mit Wärmerückgewinnung (energetische Bewertung).
Arbeitsmedizin & PSA: Bei sensibilisierenden oder reizenden Stoffen arbeitsmedizinische Prävention prüfen; PSA ergänzt, ersetzt aber nicht die technische Maßnahme.
In der Praxis … Leichtgängige Absaugarme werden häufiger korrekt nachgeführt. Das erhöht die tatsächliche Erfassungszeit und senkt die Exposition.
Häufige Fehler & Vermeidung
Zu großer Abstand der Haube: Erfassungsverlust. Lösung: ergonomische, leichtgängige Positionierungshilfen und Schulung.
Falsches System (HV/NV): Unpassende Druck-/Volumenstrompaare. Lösung: Auswahl nach Prozess, Leitungslängen und Haubengeometrie.
Nur Partikelfilter, keine Gasphase: Aldehyde bleiben unzureichend gebunden. Lösung: geeignete Gasfilter vorsehen, Sättigung überwachen.
Undichte Leitungen/Hauben: Reduzierte Wirksamkeit. Lösung: Dichtheitsprüfung, hochwertige Steck-/Dichtsysteme.
Fehlende Wartung: Volumenstrom fällt ab, Filter sättigen. Lösung: Wartungsplan, Mess-/Wechselintervalle, Protokollierung.
Kernaussage: Technisch sauber geplante Lötrauchabsaugung scheitert in der Praxis oft an Bedienung und Instandhaltung – hier entscheidet sich die Wirksamkeit.
Häufig gestellte Fragen
So nah wie möglich, ohne den Prozess zu stören. Nähe entscheidet über Wirksamkeit.
Ja, wenn Aldehyde aus Kolophonium auftreten. Partikelfilter allein reichen nicht.
Luftzirkulation oder Abführung bei einer Lötrauchabsaugung?
Lötrauchabsaugung - Filtertechnik für diverse Einsatzgebiete
Die Löttechnik wird in Handwerksbetrieben und Produktionsstätten ganz unterschiedlich eingesetzt – entsprechend muss die Löt-Absauganlage individuell angepasst werden. IVH bietet dafür verschiedene Lösungen an: Für einzelne Arbeitsplätze oder Arbeitsplatzgruppen eignen sich mobile oder stationäre Anlagen mit kleinem bis mittlerem Saugvolumen. In der Fertigung sind Zentralabsauganlagen die Lösung der Wahl. Diese haben einen großen Durchsatz, bewältigen auch hohe Lötrauchkonzentrationen und sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Selbstverständlich sind sie auch in ESD- Ausführung erhältlich. Daneben gibt es spezialisierte Absauganlagen für automatisiertes Wellenlöten, Reflowlöten und Selektivlöten.